
Sie sind längst ein riesiges Problem, weil sie Zeit, Geld und Vertrauen kosten. Viele Menschen empfinden unerwünschte Werbe-E-Mails als starke Belästigung.
In Deutschland ist der Versand unerwünschter Werbe-E-Mails zwar gesetzlich verboten, doch die Menge der weltweit täglich versandten Spam-E-Mails ist enorm. Sie machen inzwischen etwa 80 Prozent des E-Mail-Verkehrs in Deutschland aus. Auch SMS und Internet-Telegramme werden für Spam benutzt. Für Spammer ist es nicht schwierig, an Adresslisten zu gelangen, und der millionenfache Versand einer E-Mail kostet wenig. Für Nutzer und E-Mail-Anbieter ist der Werbemüll jedoch zu einem großen Problem geworden.
Viele deutsche Gerichte haben Urteile zum Themen rund um unerwünschte Werbung per Mail gefällt.
Was ist Spam?
Im Fachjargon werden die unerwünschten Werbemails UCE (Unsolicited Commercial E-Mail) und UBE (Unsolicited Bulk E-Mail) genannt. Landläufig werden sie Spam genannt, doch dies ist nicht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „SPAM“.
Schweinefleisch in Dosen
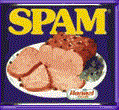
Dass dieser Begriff im Volksmund für unerwünschte Werbung wurde, soll an einem Sketch von Monty Python liegen: In einem Fernseh-Sketch erscheint ein Restaurant, in dem nur SPAM-Gerichte angeboten werden. Alles enthält SPAM, die Sandwiches, die Suppe, die Eier. Eine Frau schreit: Ich mag kein SPAM. Daraufhin grölt eine Bande Wikinger SPAM, SPAM, SPAM ….
Das Problem der Spam-E-Mails
Weltweit entstehen den Nutzern durch Spam Kosten in Höhe von jährlich etwa 10 Milliarden Euro, wie die Europäische Kommission schätzt. Nutzer müssen sich über verstopfte Postfächer und dreiste Tricks der Versender ärgern. Zudem entstehen Kosten für das Herunterladen der E-Mails. Den E-Mail-Providern entstehen durch den Datenverkehr erhebliche finanzielle Nachteile. Die Massen der Sendungen erhöhen den Bedarf an Leitungskapazität und Serverleistung. Beide können sich nur schützen. Selten gelingt es, strafrechtlich gegen die Spammer vorzugehen. Die Rückverfolgung der elektronischen Reklame ist schwierig, denn die Absenderadressen können leicht gefälscht werden. So kann eine E-Mail mit einem beliebigen Namen versehen verschickt werden, wodurch auch seriöse Firmen oder Provider in falschen Verdacht gebracht werden können.
Vorsicht Falle!
In einer Umfrage sagte eine Mehrheit der befragten E-Mail-Nutzer aus, sie hätten sich von Spam-Mails täuschen lassen. Oft werden Spam-Mails an zufällig oder systematisch generierte Adressen gesandt. Persönliche Anreden oder Ankündigungen wie „Ein kostenloses Angebot“ locken Empfänger, zu reagieren. Oder dem User wird die „Abmeldung aus dem Newsletter-Verteiler“ angeboten, mit der er sich durch Aufruf eines Links aus dem Verteiler löschen könne. Klickt der Empfänger auf den in der E-Mail enthaltenen, sogenannten „Unsubscribe-Link“, bestätigt er dadurch jedoch lediglich die Gültigkeit seiner E-Mail-Adresse und muss wahrscheinlich mit noch mehr Spam rechnen. Doch auch das bloße Öffnen einer E-Mail kann dem Versender die Gültigkeit einer E-Mail-Adresse verraten. Vorsicht ist auch bei dem Erhalt von E-Mails geboten, in denen ein Link zu einem Eingabeformular führt. Damit werden häufig persönliche Daten wie Kontodaten oder Passwörter erschlichen (Phishing).
Schutz vor Werbemüll
Die E-Mail-Anbieter versuchen, Spam schon vor Erreichen des Kundenpostfachs unschädlich zu machen. Aufgrund bestimmter Kriterien filtern sie Werbemails mit verdächtigen Inhalten (häufig beworbene Produkte, Dienstleistungen, Stichworte) oder bereits bekannte Spammer aus der Flut der elektronischen Post. Dabei wird vonseiten der Anbieter ein großer technischer Aufwand betrieben. Der weltweit größte Internet-Anbieter filtert nach eigenen Angaben täglich 2,3 Milliarden unerwünschte Spam-Nachrichten. Zusätzlich kann der Benutzer eines E-Mailpostfachs mit Filteroptionen von Anti-Spam-Programmen erreichen, dass unerwünschte Werbe-E-Mails bei Erhalt direkt im Papierkorb landen.
Um sich zu schützen, sollte der User vorausschauend und mit Sicherheit im Internet surfen, also auch möglichst wenige seiner Daten preisgeben. Denn im Internet ist auch der Adressenhandel nicht selten, bei dem Firmen persönliche Daten an Dritte verkaufen. User werden besonders bei der Teilnahme an Gewinnspielen zur Vorsicht aufgerufen. Oft dienen diese Angebote lediglich der Sammlung großer Mengen von Adressen, die dann weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt werden. Statt die eigene E-Mail-Adresse anzugeben, wird geraten, Alias-Adressen zu verwenden. Schutz vor unerwünschter Werbung soll auch durch einen Eintrag in die Robinsonliste erreicht werden können. Doch das setzt voraus, dass die Spammer diese Liste beachten. Der Verbraucherzentralen-Bundesverband (vzbv) hat eine Beschwerdestelle eingerichtet, an die Werbemails weitergeleitet werden können. Dabei sollte die Spam-E-Mail mitsamt der Header-Zeile an beschwerdestelle@spam.vzbv.de gesendet werden.
Was ist das Double-Opt-in-Verfahren?
Beim Double-Opt-in-Verfahren handelt es sich um ein zweistufiges Zustimmungsverfahren für die Anmeldung zu einem Newsletter. Damit werden die in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorgaben der DSGVO und des UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) umgesetzt. Ohne diese zweifache Willenserklärung ist ein Versand unaufgeforderter kommerzieller E-Mails nicht erlaubt.
So wird das Double-Opt-in-Verfahren durchgeführt:
- Anmeldung: Eine Person trägt ihre E-Mail-Adresse in ein Formular ein (z. B. für einen Newsletter).
- Bestätigungsmail: Die Person erhält eine automatische E-Mail mit einem Bestätigungslink.
- Erst, wenn die Person auf diesen Link klickt, wird die Anmeldung wirksam – es erfolgt also eine „double opt-in“-Bestätigung.